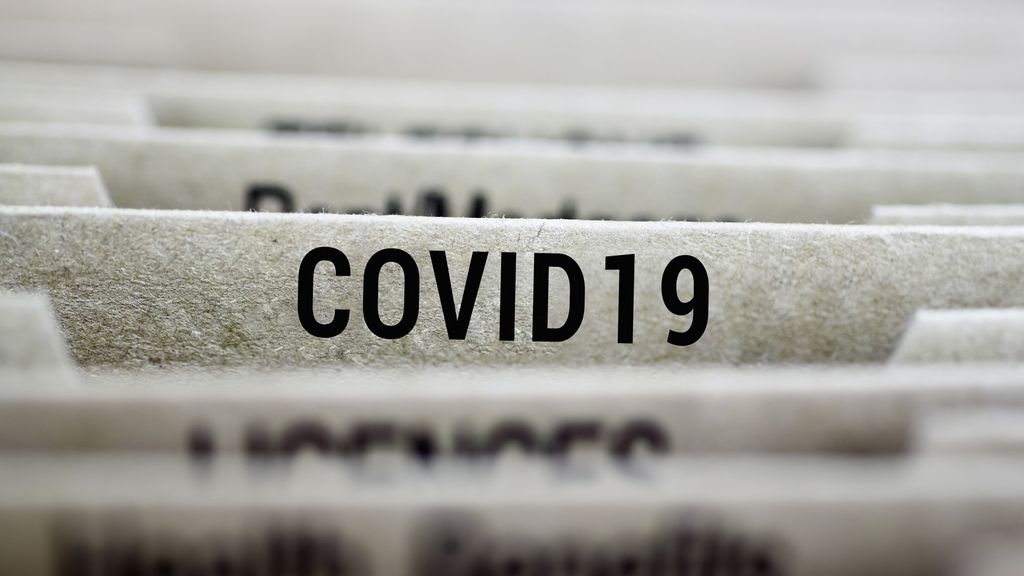
Fakten zu Covid-19
Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die Pandemie ist inzwischen ein Jahr alt, und es ist durchaus Zeit für eine erste Bilanz. OA Dr. Holger Flick von der Medizinischen Universität Graz referierte bei der Veranstaltung Pneumo Aktuell der ÖGP über den aktuellen Wissensstand.
Das Robert-Koch-Institut sagte am 24. Jänner 2020, dass mit einem Import einzelner Fälle von SARS-CoV-2 nach Europa gerechnet werden muss, dass aber bei Einhaltung geeigneter Verfahren zur Prävention und Bekämpfung von Infektionen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Sekundärfällen nach Import eines Falles als sehr gering eingeschätzt werde. Das Risiko für die Bevölkerung wurde damals als gering eingeschätzt. Wir wissen heute, dass diese Einschätzung sich als dramatisch falsch erwiesen hat“, berichtete OA Dr. Holger Flick, Klinische Abteilung für Pulmonologie, MedUni Graz.
Laut AGES-Dashboard sind zwischen 27.2.2020 und 21.2.2021 in Österreich 441742 laborbestätigte Fälle von Infektionen mit SARS-CoV-2 aufgetreten; 409863 Menschen sind genesen, 8258 sind an Covid-19 gestorben; somit gibt es 23621 aktive Fälle. Davon sind 999 auf einer Normalstation und 261 auf einer Intensivstation hospitalisiert. „Nach meiner Schätzung wurden inzwischen mindestens 37000 Patienten im Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt, die Krankenhausletalität liegt bei etwa 18%“, erläuterte der Infektiologe.
Charakteristika der Erkrankung
Die Inkubationszeit von Covid-19 beträgt im Median fünf bis sechs Tage. Es gibt eine Gruppe von 15 bis 31% der Infizierten (nach anderen Quellen bis zu 45%), die völlig asymptomatisch bleibt. Die überwiegende Mehrheit hat leichte bis mittelschwere Symptome. Nur weniger als 5% haben einen schweren Verlauf. Die schwere Form von Covid-19 entwickelt sich typischerweise sieben bis zehn Tage nach Symptombeginn. Eine intensivmedizinische Behandlung und Beatmung ist bei weniger als 25% der hospitalisierten Patienten erforderlich. Alarmsignale für schwere Verläufe sind Atemnot, Tachypnoe und/oder ein Abfall der Sauerstoffsättigung unter 94%. Neben der Pneumonie kann es bei schweren Covid-19-Verläufen zu einem ausgeprägten Endothelschaden der Lungengefäße mit intravaskulären Thrombosierungen sowie thromboembolischen Ereignissen, einer massiven Zytokinausschüttung und einem Multiorganversagen kommen. Die häufigsten Symptome sind Husten, Fieber und Halsschmerzen. Der immer wieder in den Medien zitierte Verlust von Geruchs- und/oder Geschmackssinn tritt bei etwa einem Fünftel der Betroffenen auf. Etwa 1% der Infizierten entwickelt eine schwere Pneumonie, die intensivpflichtig werden kann.
Todesrate ist nicht Todesrate
Bezüglich der Todesraten muss zwischen „infection fatality rate“ (IFR) und „case fatality rate“ (CFR) unterschieden werden. Die IFR ist die Rate an Todesfällen, bezogen auf alle Infizierten (schließt also infizierte Personen, die asymptomatisch sind, ein; naturgemäß kann diese Gesamtzahl oft nicht ganz exakt angegeben werden). Im Gegensatz dazu ist die CFR die Rate an Todesfällen unter den klinisch Erkrankten, sie ist also naturgemäß höher. So betrug z.B. in New York City im Frühjahr 2020 die IFR 1%, die CFR jedoch 8%.
Faktum ist, dass die IFR von Covid-19 mit fortschreitendem Lebensalter nicht linear, sondern exponentiell ansteigt, liegt sie bei einem 10-Jährigen bei etwa 0,001%, bei einem 85-Jährigen jedoch bei 15 bis 20%.
Die Gesamt-IFR von Covid-19 liegt je nach geografischer Region zwischen 0,5% und 2,7%, wobei diese Unterschiede zum Großteil die verschiedener Altersstrukturen diverser Populationen widerspiegeln. Zum Vergleich: Die IFR der saisonalen Influenza liegt bei 0,1%.
Der weitaus überwiegende Teil der an Covid-19 Gestorbenen war älter als 65 Jahre, die meisten sogar älter als 75.
Zahlen aus Deutschland zeigen, dass die Letalität von Covid-19 ähnlich wie bei anderen Formen der CAP vor allem vom Alter und den Komorbiditäten abhängt.
Was allerdings auffällt: Bei Covid-19 sind Patienten mit Diabetes, Nieren- und Herzerkrankungen stärker betroffen als bei anderen Pneumonien; auch das Alter scheint bei Covid-19 eine etwas größere Rolle zu spielen. Hingegen schneiden Patienten mit Lungenerkrankungen bei Covid-19 eher besser ab als z.B. Patienten mit Pneumokokkenpneumonien.
„Wir haben in einem Jahr in Österreich nun über 8000 Covid-19-Todesopfer und wir haben nach wie vor einen Lockdown“, kommentierte Flick. „Was aber nicht so sehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist: dass jedes Jahr in Österreich ca. 14000 Menschen an den Folgen des Rauchens sterben. Deshalb frage ich mich manchmal, ob wir nicht so etwas wie einen Nikotin-Lockdown brauchen“, fragte der Pneumologe überspitzt.
Wer ist besonders gefährdet?
Eine Cluster-Analyse der Ständigen Impfkommission in Deutschland zeigt klar, dass es drei Gruppen gibt, die mit Abstand das höchste Risiko für Hospitalisierung und Mortalität bei Covid-19 tragen. Dies sind (in absteigender Reihenfolge) Personen ab 80 Jahren, Personen mit Trisomie 21 und Personen von 70 bis 79 Jahren. Das erhöhte Risiko für Personen mit Trisomie 21 erklärt sich wahrscheinlich aus den in dieser Gruppe häufigen Komorbiditäten wie angeborenen Herzerkrankungen, Immunschwächen etc.
Eine Komorbidität, die das Risiko für einen letalen Verlauf von Covid-19 massiv erhöht, ist die Herzinsuffizienz, gefolgt von Rauchen. Aber auch Alter über 50 Jahre, Übergewicht bzw. Adipositas, Lungenerkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Hypertonie, Malignome, Diabetes mellitus, zerebrovaskuläre Erkrankungen und männliches Geschlecht erhöhen — in unterschiedlichem Ausmaß — das Sterberisiko.
Bei Patienten mit Lungenkarzinom, die Covid-19 bekommen, liegt die Letalität um die 25%, ähnlich hoch ist die Letalität bei Covid-19-Patienten nach Organtransplantationen. Bei Patienten mit interstitiellen Lungenerkrankungen beträgt die Letalität sogar 49%.
Wenn Covid-19 nicht zum Tod führt, kann es durchaus langfristige Folgen geben („long Covid“), wie etwa lang anhaltende Müdigkeit, Muskelschwäche, Schlafstörungen, Angst und Depression oder auch Diffusionsstörungen der Lunge.
Therapie
Zunächst ist zu sagen, dass natürlich nicht Covid-19 behandelt wird, sondern der ganze Patient, was alle Komorbiditäten einschließt. Wichtig ist auch, dass die Behandlung rechtzeitig begonnen wird. Auch die Qualität der medizinischen Versorgung spielt natürlich eine Rolle – damit ist hier gemeint, dass ausreichend Personal, ausreichend Sauerstoff und ausreichend Beatmungsmöglichkeiten vorhanden sein müssen. Es müssen auch die Ressourcen vorhanden sein, um Komplikationen adäquat behandeln zu können. Spezifische Medikamente gegen Covid-19 sind derzeit mehr ein Wunsch als eine Realität. „Aus pneumologischer Sicht ist – gerade weil es noch keine spezifischen Medikamente gegen Covid-19 gibt – klar, dass eine Covid-19-Pneumonie mit einigen Abänderungen grundsätzlich nach den existierenden Leitlinien für Pneumonien behandelt werden sollte“, forderte Flick. „Mit nicht ausreichend validierten Therapien sollte man eher zurückhaltend sein“, so der Pneumologe. „Experimentelle Therapien sollten außerhalb von klinischen Studien nur in ausgewählten und gut begründeten Fällen Verwendung finden.“
„Die wichtigste Therapiemaßnahme bei schweren Covid-19-Verläufen ist die Verabreichung von Sauerstoff – obwohl es gerade dazu gar keine Studien gibt“, so Flick. Der nächste Schritt ist High-Flow-O2 bzw. nicht invasive Beatmung; genügt auch das nicht, so muss der Patient intubiert werden. Remdesivir kann in der Frühphase (≤10 Tage nach Symptombeginn) bei hospitalisierten, nicht beatmeten Patienten mit O2-Bedarf gegeben werden. Dexamethason spielt eine wichtige Rolle und sollte bei Patienten mit einer SpO2 <90%, mit ARDS, Sepsis oder Beatmung gegeben werden.
Eine Thromboembolieprophylaxe wird bei hospitalisierten Patienten in prophylaktischer Standarddosis oder bei Risikopatienten in halbtherapeutischer Dosis gegeben. Faktoren, die hier über das Risiko entscheiden, sind u.a. ein BMI >35kg/m2, ein St.p. tiefer Venenthrombose, Intensivpflichtigkeit und D-Dimer >2–3mg/dl. „Die Indikation für Dexamethason beruht vor allem auf den RECOVERY-Daten“, bemerkte Flick. „Es gibt daran allerdings auch Kritikpunkte, etwa die relativ hohe Basismortalität im Vergleich zu anderen Studien, die eher kleine Zahl von Patienten über 70 Jahre, den Anteil von ca. 10%, die möglicherweise gar kein Covid-19 hatten, und den Anteil von 20%, die chronische Lungenerkrankungen aufwiesen.“
Die Kombination von Remdesivir mit dem JAK-Inhibitor Baricitinib konnte zwar vs. Remdesivir allein die Letalität nicht signifikant verbessern, wohl aber die Zeit bis zur klinischen Erholung.
Die Daten für Rekonvaleszentenplasma zeigen bei schweren Covid-19-Verläufen keinen Vorteil im Vergleich zu Placebo. Anders scheint dies zu sein, wenn Rekonvaleszentenplasma bei Patienten ab 75 Jahren sehr früh, nämlich innerhalb von 72 Stunden nach Symptombeginn, verabreicht wird. Dies reduzierte die Rate schwerer Verläufe signifikant.
Quelle:
Vortrag „Infektiologie“ von OA Dr. Holger Flick, Medizinische Universität Graz, im Rahmen des (virtuellen) 8. Pneumo Aktuell der ÖGP am 22. Jänner 2021
Literatur:
beim Vortragenden
Das könnte Sie auch interessieren:
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumyeirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.At vero eos et accusam et justo ...
