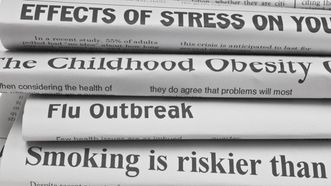
26. August 2020
Neues Konzept zur Schlaganfall-Nachsorge
„Stroke-Card“ verbessert Lebensqualität und reduziert das Risiko für weitere Schlaganfälle
Während es für die Nachbehandlung einer Krebserkrankung oder eines Herzinfarkts eine standardisierte Vorgangsweise gibt, fehlt nach einem Schlaganfall ein solches einheitliches Konzept. Zukünftig könnte hier das österreichische „Stroke-Card“-Konzept Anwendung finden. Die wissenschaftliche Evidenz liefert eine Studie des Epidemiologen Priv.-Doz. DDr. Peter Willeit, die von der Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie initiiert worden ist. In Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien konnten 2149 Patienten in die Untersuchung, die von Jänner 2014 bis Dezember 2017 lief, eingeschlossen werden. 1438 Patienten wurden dabei nach dem Behandlungskonzept „Stroke-Card“ behandelt und 711 erhielten die Standardbehandlung. Neben einer gesteigerten Lebensqualität zeigte sich, dass auch die Rate der kardiovaskulären Folgeerkrankungen zurückging. Das Risiko konnte von 8,3 Prozent auf 5,4 Prozent, also um etwa ein Drittel, reduziert werden.
Das „Stroke-Card“-Konzept sieht vor, dass das multidisziplinäre Stroke-Team des Akutkrankenhauses für die Patienten auch nach stationärer Entlassung für weitere drei Monate neben dem Hausarzt Ansprechpartner bleibt. Diese Teams, bestehend aus Pflegern, Therapeuten und Ärzten, haben sich in der Akutbehandlung, die in Österreich durchschnittlich neun Tage dauert, bereits bewährt. Nach der Entlassung können die Patienten mit einer personalisierten App ihre Risikofaktoren überwachen. Mittels Fragebogen werden Daten zur Lebensqualität und zu Folgeerkrankungen erhoben. Nach drei Monaten kommen die Patienten erneut für eine umfassende ambulante Nachsorgeuntersuchung durch das Stroke-Team ins Krankenhaus. „Bisher gab es keine einfachen, gut umsetzbaren Konzepte, um Patienten nach einem Schlaganfall standardisiert zu versorgen“, erklärt der Neurologe Prof. Dr. Johann Willeit. „Dieses Konzept ist verhältnismäßig einfach umzusetzen und aufgrund der Betreuung durch ein Team, das die Patienten bereits kennt, sehr effektiv und für die Patienten motivierend“, berichtet Prof. Dr. Stefan Kiechl, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie. Basierend auf den guten Erfahrungen durch die Studie, wird in Innsbruck das neue Behandlungsmodell als Standard eingeführt und hat gute Chancen, in ganz Österreich und weiteren Ländern zum Einsatz zu kommen.
Quelle:
Presseaussendung der Medizinischen Universität Innsbruck vom 28.Juli2020