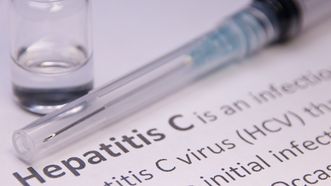
25. April 2022
Let’s end hepatitis C in Vienna
Niedrigschwelliger Zugang als Schlüssel zur erfolgreichen Therapie
Das Hepatitis-C-Virus (HCV) ist weltweit verbreitet und stellt ein bedeutendes medizinisches Problem dar. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass weltweit etwa 70 Millionen Menschen chronisch mit HCV infiziert sind. Es wird vermutet, dass in Österreich etwa 20000–30000 Menschen an einer chronischen Hepatitis C leiden.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf allgemeineplus.at und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. universimed.com & med-Diplom.at)
Unbehandelt kann eine chronische Hepatitis C zu einer Leberzirrhose und zu einem hepatozellulären Karzinom fortschreiten. Es ist deshalb wichtig, möglichst frühzeitig die Diagnose zu stellen und rechtzeitig – bevor sich Komplikationen einer fortgeschrittenen Lebererkrankung entwickeln – eine effektive antivirale Therapie einzuleiten.
Moderne Therapiekonzepte bei chronischer Hepatitis C
Das Therapieziel bei chronischer Hepatitis C ist eine vollständige Viruselimination. Eine solche ist erreicht, wenn zwölf Wochen nach Therapieende kein Virus im Serum des Patienten nachweisbar ist: In diesem Zusammenhang spricht man von einer SVR12 (d.h. einer „sustained virological response“ zwölf Wochen nach Therapieende). Seit einigen Jahren stehen hochwirksame Substanzen zur Verfügung, die zusammenfassend als „direct acting antivirals“ (DAA) bezeichnet werden und spezifisch drei vom HCV-Genom codierte Enzyme (NS3/4A-Protease, NS5B-Polymerase sowie das Enzym NS5A) hemmen, die für die Virusreplikation erforderlich sind. Je nachdem, welches der drei genannten Enzyme gehemmt wird, werden bei DAA Proteasehemmer, Polymerasehemmer und NS5A-Hemmer unterschieden. Zahlreiche Studien konnten zeigen, dass durch Kombination von zwei (oder drei) DAA aus unterschiedlichen Wirkstoffklassen eine Heilung der chronischen Hepatitis C ohne relevante Nebenwirkungen bei einer Therapiedauer von meist nur 8–12 Wochen möglich ist. Die bevorzugt eingesetzten Therapieregime sind pangenotypisch (d.h. bei allen HCV-Genotypen wirksam), sodass vor Therapiebeginn streng genommen eine Bestimmung des HCV-Genotyps nicht nötig wäre.
Das Ziel der WHO – Elimination der Hepatitis C bis 2030
Aufgrund der nun zur Verfügung stehenden hocheffektiven Therapieregime formulierte die WHO 2015 das engagierte Ziel einer Elimination der Hepatitis C bis zum Jahr 2030, wobei der Begriff Elimination als eine Reduktion der Neuinfektionen um 90% und eine Reduktion der HCV-induzierten Todesfälle um 65% bis 2030 (im Vergleich zum Jahr 2015) definiert wurde. Zusätzlich sollten bis zum Jahr 2030 90% aller HCV-Fälle diagnostiziert sein und 80% mit einer Behandlung begonnen haben.
Wie kann das Ziel einer HCV-Elimination in Österreich erreicht werden?
Am höchsten ist in Industrienationen wie Österreich die Prävalenz der chronischen HepatitisC bei Patienten mit vergangenem oder aktuellem intravenösem Drogenkonsum („people who inject drugs“; PWID); gleichzeitig wurden PWID jedoch bisher in einem hohen Prozentsatz nicht behandelt bzw. wurde ihre Infektion noch nicht diagnostiziert, da viele von ihnen nur mangelhaft an das Gesundheitssystem angebunden sind. Um die hochgesteckten Ziele der WHO zu erreichen, ist es daher von entscheidender Bedeutung, spezielle Settings für HCV-Screening und HCV-Therapie zu entwickeln, die von PWID auch angenommen werden. In Wien wurden deshalb bereits vor einigen Jahren in Kooperation zwischen dem Ambulatorium Suchthilfe Wien und der 4. Medizinischen Abteilung der Klinik Ottakring mehrere Projekte initiiert, deren Ziel in der Elimination der HepatitisC in der Population der PWID besteht und die unter dem Titel „Let’s end hepatitisC in Vienna“ zusammengefasst werden. In diesem Artikel berichten wir auch über den aktuellen Stand des Therapieprojektes.
Herausforderungen und Chancen bei der HCV-Therapie von PWID
PWID mit guter Compliance können – unabhängig davon, ob noch ein aktiver Drogenkonsum besteht oder nicht – problemlos über ein hepatologisches Zentrum behandelt werden. Ein beträchtlicher Teil aller PWID, für die wir den Begriff „PWID mit einem hohen Risiko für Non-Adhärenz bei der antiviralen Therapie“ prägten, ist jedoch durch folgende Charakteristika gekennzeichnet:
Aufgrund der Suchterkrankung und psychiatrischer Begleiterkrankungen sind diese Menschen nicht in der Lage, die Termintreue aufzubringen, die für eine Therapie über ein Schwerpunktkrankenhaus erforderlich wäre. Darüber hinaus wäre aufgrund der reduzierten Compliance die Gefahr sehr groß, dass die antivirale Therapie nicht regelmäßig eingenommen würde, wenn ihnen – wie im Standardsetting üblich – eine Monatspackung zur selbstständigen Einnahme daheim mitgegeben würde.Bei einem Großteil dieser PWID besteht ein aktiver Drogenkonsum und praktisch alle weisen klinisch relevante psychiatrische Begleiterkrankungen sowie einen kritischen psychosozialen Status auf: Der Großteil ist arbeitslos, viele sind ohne eigene Wohnung, nur wenige leben in einer stabilen Beziehung und etwa zwei Drittel berichten über oft mehrfache Haftaufenthalte.
Trotz all der genannten Probleme weisen diese Patienten jedoch in einem Punkt eine (fast) perfekte Compliance auf: Sie besuchen täglich ihre Apotheke (oder eine niedrigschwellige Einrichtung), um dort unter Aufsicht ihre Opioid-Substitutionstherapie (OST) einzunehmen.
Ein neues „Setting“ für die Therapie von „PWID mit einem hohen Risiko für Non-Adhärenz bei der antiviralen Therapie“
Die zentrale Idee unseres Projekts besteht daher darin, die Einnahme der antiviralen Therapie mit der Einnahme der OST zu kombinieren.
Es erfolgte ein Zusammenschluss zwischen Klinik Ottakring, Suchthilfe Wien gGmbH und Verein Dialogzu einem großen hepatologischen Zentrum. Weil viele PWID eine Behandlung in Schwerpunktkrankenhäusern nicht akzeptieren, wurde zusätzlich zu der in der Klinik Ottakring bestehenden Hepatitisambulanz eine zweite, niedrigschwellige Hepatitisambulanz im Ambulatorium der Suchthilfe Wien eingerichtet. Bei der Suchthilfe Wien (Abb.1) handelt es sich um eine niedrigschwellige Einrichtung, die ein fast perfektes „Setting“ für die Therapie von PWID darstellt, da sie über die gesamte Infrastruktur verfügt, die für eine umfassende Betreuung dieser Patientengruppe erforderlich ist. Sie bietet unter anderem ein Tageszentrum, eine Notschlafstelle, ein Spritzentauschprogramm sowie ein Ambulatorium mit Suchtmedizinern, Psychiatern, Pflegepersonen, Sozialarbeitern, HIV-Spezialisten und Hepatologen.
An beiden Ambulanzen werden alle diagnostischen Maßnahmen, die vor, während und nach einer antiviralen Therapie der Hepatitis C erforderlich sind, angeboten. Kommt das betreuende Team zu der Auffassung, dass ein hohes Risiko besteht, dass ein Patient die antivirale Therapie daheim nicht regelmäßig einnehmen würde, so erhält dieser die HCV-Therapie täglich gemeinsam mit der OST in der gewohnten Apotheke (unter Aufsicht eines Apothekers) oder in der Suchthilfe Wien (unter Aufsicht eines Arztes oder einer Pflegeperson). Durch diese Strategie einer „directly observed therapy“ kann eine sichere tägliche Medikamenteneinnahme gewährleistet werden.
Vorläufige Ergebnisse des Therapieprojektes
Bis zum heutigen Tag konnten wir bei insgesamt 607 PWID mit einer antiviralen Therapie entsprechend dem Konzept der „directly observed therapy“ beginnen. Bei den 479 Patienten, welche die antivirale Therapie und die 12-wöchige Nachbeobachtungsphase beendet haben, betrug die SVR12-Rate (d.h. die Rate der virologischen Heilung) über 99%.
Dieses hervorragende Ergebnis ist dadurch zu erklären, dass durch das Konzept der „directly observed therapy“ eine nahezu perfekte Medikamenteneinnahme erreicht werden konnte: Nur 0,2% der Visiten für die Einnahme der antiviralen Therapie gemeinsam mit der OST wurden von den Patienten versäumt.
Angemerkt werden muss, dass diese beeindruckenden Resultate nur durch das sehr große Engagement des Teams der Suchthilfe Wien erzielt werden konnten. Erschien ein Patient nicht zur vereinbarten Visite, wurde er umgehend telefonisch erinnert, und war er telefonisch nicht erreichbar, so wurden Spitäler und Haftanstalten kontaktiert, um den Patienten zu orten und bei Bedarf die antivirale Therapie in das entsprechende Spital bzw. die entsprechende Haftanstalt zu bringen und dadurch eine Therapieunterbrechung zu vermeiden. Ein weiterer Faktor, ohne welchen diese Ergebnisse nicht erzielt werden hätten können, ist die hervorragende Zusammenarbeit mit inzwischen weit mehr als 100 Apotheken in Wien und Umgebung, bei welchen wir uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken möchten.
Alle Patienten werden regelmäßig über die zur Vermeidung von Reinfektionen nötigen Maßnahmen instruiert; dementsprechend ist die Reinfektionsrate im Rahmen des Projektes mit 4,4% relativ niedrig. Unser Team arbeitet intensiv an Strategien, um das Risiko für Reinfektionen noch weiter zu senken.


